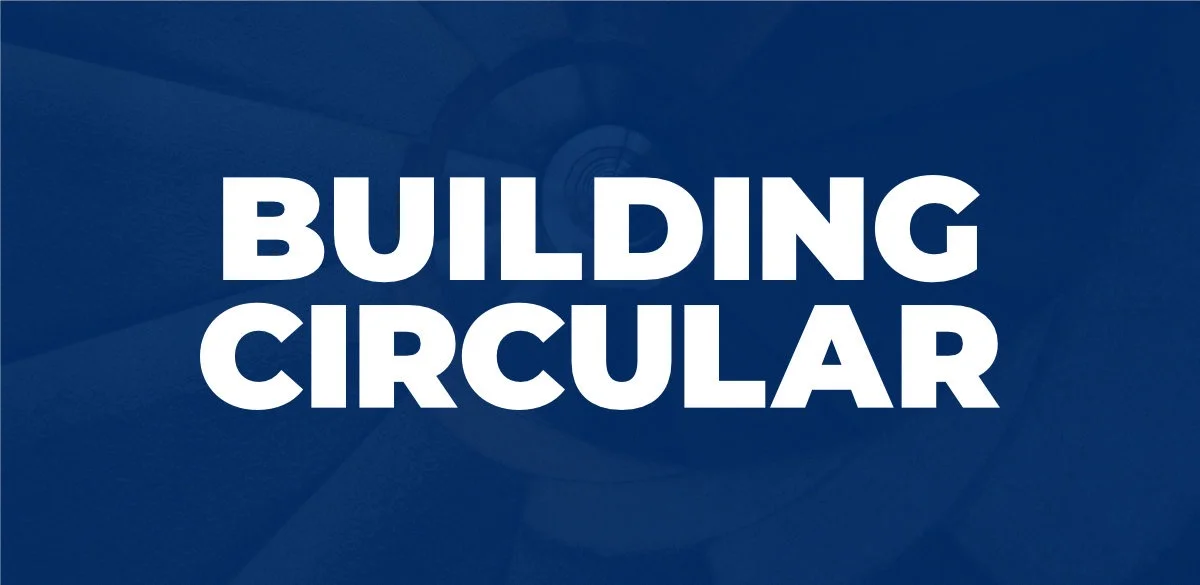Building Circular
Transformation zu einer zirkulären Bauwirtschaft
Montag, 23. September 2024 | Online Event
Kommission Nachhaltiges Bauen am Umweltbundesamt: Gebäude als Werkstofflager betrachten und nutzen
Die Kommission Nachhaltiges Bauen (KNBau) legt anlässlich der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie eine Vision für eine zirkuläre Bauwirtschaft vor. Zahlreiche Maßnahmenvorschläge skizzieren die Transformation zu einer Bauwirtschaft in planetaren Grenzen:
Nur ca. 10 % aller im Gebäudebestand eingelagerten Baustoffe sind wirklich auf derselben Qualitätsstufe recycelbar. Ca. 90 % gehen mit Qualitätsverlust in ein Downcycling oder durch Verfüllungen, Verbrennungen oder Deponierung ganz verloren.
Von jährlich ca. 220 Mio. Tonnen mineralischen Bauabfällen werden ca. 77 Mio. t (35 %) zu „Recycling“-Material verarbeitet. Nur 15 Mio. Tonnen (6,8 %) finden Verwertung in der Asphalt- und Betonherstellung. Knapp 75 % des „Recycling“-Materials geht in den Erd- und Straßenbau: Dies ist jedoch kein Recycling auf gleicher Qualitätsstufe, sondern ein klares Downcycling. Weitere 7,2 % der „Recycling“-Baustoffe werden der „Sonstigen Verwertung“ zugeführt, größtenteils der Geländeverfüllung, die jedoch im Sinne der Abfallhierarchie kein Recycling ist.
Gemeinsam diskutieren wir unter anderem:
- Verständnis für Zirkulärwirtschaft
- Gebäudebestand nutzen & schützen
- Zirkularität messbar & transparent machen
- Verantwortung gerecht verteilen
- Abfallhierarche zu Ressourcenschutzhierarchie wandeln
Event-Zusammenfassung (KI)
Transformation zu einer zirkulären Bauwirtschaft
Am 23. September 2024 fand das Fach-Webinar "BUILTWORLD" statt, bei dem sich namhafte Experten wie Prof. Dr. Dirk Schwede von der Universität Stuttgart und Prof. Josef Steretzeder von der Technischen Hochschule Deggendorf intensiv mit der Zukunft der Bauwirtschaft auseinandersetzten. Ziel der Veranstaltung war es, den Wandel hin zu einer zirkulären Bauwirtschaft zu diskutieren und innovative Ideen vorzustellen, die dieser Entwicklung den Weg ebnen könnten.
Im Zentrum der Diskussion stand der notwendige, tiefgreifende Wandel in der Bauwirtschaft, der in einem neu entwickelten Positionspapier dargelegt wurde. Dieses Papier definiert die Anforderungen für eine nachhaltige Transformation der Branche und fordert eine grundlegende Neugestaltung der Bauweise sowie der zugrunde liegenden Prozesse. „Das Verständnis für eine neue Kreislaufwirtschaft muss gefördert werden“, betonte Prof. Schwede. Dabei ist die klare Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten aller Beteiligten – von Bauherren über Produkthersteller bis zu Planern – von zentraler Bedeutung.
R-Strategien als Kernelement
Ein wesentliches Thema war der Einsatz der sogenannten R-Strategien, die sich auf die Verlangsamung und Verlängerung von Stoffkreisläufen konzentrieren. Diese Strategien, zu denen „Wiederverwendung“, „Weiterverwendung“ und „Reparatur“ gehören, zielen darauf ab, die Lebensdauer von Baumaterialien und -strukturen zu maximieren. „Die Annahme, Recycling alleine würde einen geschlossenen Kreislauf bedeuten, ist weit verbreitet, jedoch falsch“, stellte Prof. Steretzeder klar. Vielmehr müsse der Fokus darauf liegen, Produkte so zu gestalten, dass sie von Anfang an wiederverwendbar und verwertbar seien.
Der Wissenstransfer in die Breite der Branche wurde als essenziell für die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategien angesehen. Dazu äußerte sich Prof. Schwede: „Wir sind dabei, die erforderlichen Zahnräder zu entwickeln, damit alle Akteure diese Herausforderungen meistern können.“ Die Implementierung der R-Strategien wird als zentraler Baustein beschrieben, um die Nachhaltigkeitsziele der Bauwirtschaft zu erreichen und die sektoralen CO₂-Emissionen signifikant zu senken.
Materialkreislauf-Labels und Top-Runner-Modell
Die Diskussion um innovative Ansätze zur Förderung der Kreislaufwirtschaft beinhaltete auch Überlegungen zur Einführung von Materialkreislauf-Labels. Diese Labels sollen sowohl Herstellern als auch Verbrauchern klare Informationen über die Zirkularität von Bauprodukten bieten. Prof. Steretzeder führte aus: „Es braucht idealerweise auch eine Kennzeichnung, da nur so übergeordnete Plattformen geschaffen werden könnten, die diese Informationen digital zusammenführen.“
Ein weiteres vielversprechendes Konzept ist das Top-Runner-Modell, das von Prof. Dr. Schwede erläutert wurde. Es zielt darauf ab, die besten Materialien und Konstruktionen zu identifizieren und als Standards sichtbar zu machen, während weniger effiziente Alternativen vom Markt verdrängt werden. „Orientiert man sich immer an dem weitestgehenden“, erklärte Schwede, „wird die Marktmechanismen genutzt, um Innovationen voranzutreiben und die potentesten Technologien zu fördern.“
Herausforderung der Taxonomie und finanzielle Anreize
Die Experten wiesen auch auf die Komplexität der Taxonomie hin, die von Prof. Steretzeder als "bürokratisches Monster" bezeichnet wurde. Diese Vorgaben stellen eine erhebliche Herausforderung dar, könnten jedoch als Instrument der Kreislaufwirtschaft fungieren, sobald die Hürden überwunden seien. Zudem wurde über die Bedeutung von Subventionen diskutiert, um den Erhalt und die Förderung des Bestandsbauens zu unterstützen. „Nur durch adäquate finanzielle Anreize können umfassende Ressourceneffizienz-Strategien umgesetzt werden“, unterstrichen die Experten.
Abschließende Betrachtungen
Die Experten sind sich einig, dass die Kreislaufwirtschaft in der Bauindustrie immense Potenziale birgt, um ökologische Herausforderungen zu bewältigen. Der allgemeine Zustand des deutschen Gebäudebestands offenbart die Notwendigkeit einer konsequenten Umsetzung dieser Ansätze. Angesichts der enormen Ressourcenmengen, die jährlich im Bauwesen bewegt werden, kann die Transformation hin zur Kreislaufwirtschaft nicht nur zur Senkung der Emissionen beitragen, sondern auch die ökologischen Grundlagen für zukünftige Generationen sichern.
Zum Abschluss der Veranstaltung betonte Prof. Dr. Schwede: „Verantwortung und Haftung müssen klar verteilt werden, um Innovationshemmnisse in der Branche abzubauen.“ Diese klaren juristischen und planerischen Rahmenbedingungen sind essentiell, um den zirkulären Ansatz im Bauwesen nachhaltig zu fördern und langfristige Veränderungen anzustoßen.
Die Veranstaltung "BUILTWORLD" hinterlässt einen bleibenden Eindruck in der Bauwirtschaft. Sie zeigt deutlich, dass der Übergang zu einer zirkulären Bauwirtschaft weit mehr als nur ein theoretisches Konzept ist. Es ist eine zwingende Notwendigkeit, um die zukünftigen Herausforderungen der Branche zu meistern. Die hier gewonnenen Erkenntnisse und vorgestellten Modelle bieten eine solide Grundlage für die Transformation des Bausektors in eine nachhaltige Zukunft.
Panelisten
Relevante Beiträge

Recyclingbeton herstellerneutral ausschreiben

Gips Rohstoffe: Engpass voraus?