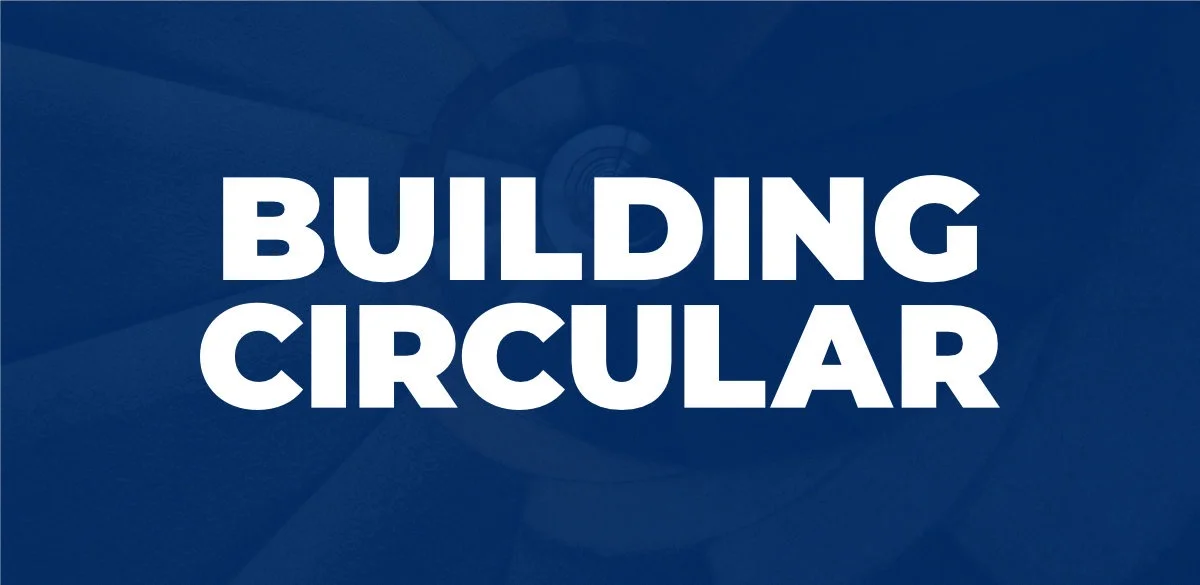Building Circular
CO2-reduzierter 3D-Druck mit 100% rezyklierter Gesteinskörnung
Montag, 17. Februar 2025 | Online Event
Zukunftsweisende 3D-Drucktechniken für nachhaltiges Bauen
Das Forschungsprojekt “Innobau 3D” an der Hochschule München zielt darauf ab, neue Druckmaterialien für die 3D-Drucktechniken Extrusion und Partikelbettdruck zu entwickeln. Dabei werden regionale Ausgangsstoffe, einschließlich grober, leichter und rezyklierter Gesteinskörnungen, verwendet. Eine besondere Herausforderung stellt die Verwendung von Wasser saugenden Körnungen dar. Das Projekt optimiert die mechanischen und dämmenden Eigenschaften der Druckmaterialien und untersucht deren Materialfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Optimierung der Zugtragfähigkeit, um die Materialien für tragende Strukturen im Bauwesen nutzbar zu machen. Mit den neu entwickelten Materialien werden neue Bauteil- und Tragstrukturen für 3D-gedruckte tragende Bauteile entwickelt. Dies umfasst auch die Modellierung des Tragverhaltens und die Entwicklung geeigneter Prüfverfahren zur Qualitätssicherung.

Event-Zusammenfassung (KI)
CO2-reduzierter 3D-Druck mit 100% rezyklierter Gesteinskörnung
Im Rahmen der Fachveranstaltung „CO2-reduzierter 3D-Druck“ kamen führende Experten der Bauindustrie zusammen, um über innovative Ansätze zur Reduktion von CO2-Emissionen im Bauwesen zu diskutieren. Prof. Dr. Thorsten Stengel von der Hochschule München und Dr. Fabian Meyer-Brötz von der Peri GmbH beleuchteten in ihren Vorträgen die neuesten Entwicklungen, Herausforderungen und Perspektiven dieser zukunftsweisenden Technologie.
Der 3D-Druck im Bauwesen, insbesondere in der Betonanwendung, steht im Fokus zahlreicher Forschungsinitiativen. Ziel ist es, CO2-Emissionen durch innovative Drucktechnologien und die Nutzung rezyklierter Materialien signifikant zu reduzieren. Prof. Dr. Thorsten Stengel, ein Experte für Baustoffkunde, hob in seinem Beitrag die zentrale Rolle der Materialforschung hervor. Er betonte, dass die Anwendung von rezyklierter Gesteinskörnung sowie CO2-armen Druckmaterialien entscheidend ist, um die Nachhaltigkeit in der Baubranche zu verbessern. "Unser Ziel ist es, den Zementgehalt in Betonmischungen auf unter 200 kg pro Kubikmeter zu reduzieren", so Stengel, um das Globale Erwärmungspotenzial der Baubranche zu senken.
Ein zentrales Forschungsprojekt in Bayern, „Inno Bau 3D“, zielt auf die Entwicklung und Optimierung von Druckmaterialien ab. Hierbei spielen zwei unterschiedliche Drucktechniken eine Rolle: der Extrusionsdruck und der Partikelbettdruck. Während die Peri GmbH ihre Expertise im Bereich des Extrusionsdrucks einbringt, arbeitet die Fit AG mit am Partikelbettdruck. Dies ermöglicht es, die spezifischen Anforderungen neuer Baustoffe zu erfüllen und die mechanischen Eigenschaften sowie die Druckbarkeit der Materialien zu verbessern.
Dr. Fabian Meyer-Brötz von der Peri GmbH betonte die Bedeutung der Digitalisierung und Automatisierung im Bauprozess, um die Implementierung des 3D-Drucks praktikabler zu machen. In diesem Zusammenhang sind auch strukturelle Veränderungen innerhalb der Bauindustriepraxis notwendig, da die Produktivität in diesem Sektor seit Jahrzehnten stagniert. Meyer-Brötz unterstrich, dass innovative Lösungen erforderlich sind, um den Herausforderungen der Branche, wie Fachkräftemangel und Wohnungsnot, effektiv zu begegnen. "Unser Ziel war es, mit Automatisierung reale Produktivitätssteigerungen zu erzielen", erklärte er.
Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war die Vorstellung eines Pilotprojekts in der Schweiz, bei dem ein 3D-gedrucktes Gebäude unter Verwendung lokaler Gesteinskörnungen realisiert wurde. Dies trug nicht nur zur Reduzierung von Transportkosten bei, sondern minimierte auch die Umweltauswirkungen. Dies verdeutlicht das Potenzial der Technologie, den Betonverbrauch, bekanntlich ein wesentlicher Verursacher von CO2-Emissionen, zu senken. Prof. Dr. Stengel ergänzte, dass alternative Bindemittel wie Vulkanasche zur Verbesserung der Materialeigenschaften – etwa in Bezug auf Chloridbeständigkeit – beitragen könnten.
Die Optimierung der Packungsdichte von Betonmischungen ist ein weiterer entscheidender Ansatz, den Prof. Dr. Stengel vorstellte. Dabei wird der Einsatz von Portlandzement auf weniger als 200 kg pro Kubikmeter zurückgefahren, was sowohl zu einer erheblichen Einsparung von Ressourcen als auch zu einer Senkung des CO2-Ausstoßes führt. "Mit etwa 200 kg Zement können wir problemlos einen C20/25 nach 28 Tagen erreichen," erklärte Stengel.
Ein wesentlicher Diskussionspunkt waren die Genehmigungsverfahren für neue Materialien und Bauweisen, die laut Dr. Meyer-Brötz eine der größten Hürden auf dem Weg zur Marktreife darstellen. Die Einbindung deutscher Baubehörden wurde jedoch als positiv hervorgehoben, da sie sich konstruktiv in den Prozess einbringen. Dr. Meyer-Brötz fasste zusammen: "Was wir technologisch umsetzen können, müssen wir auch genehmigungsrechtlich durchsetzen."
Schließlich betonte Dr. Meyer-Brötz die Notwendigkeit, die Fragmentierung der Bauindustrie zu überwinden, um den Wandel hin zu nachhaltigeren Baupraktiken erfolgreich zu gestalten. Besonders der 3D-Druck, der längerfristig zwar nicht die alleinige Baumethode darstellen wird, aber einen festen Platz als Bauverfahren einnehmen könnte, steht hierbei im Fokus. Die wissenschaftliche Akademisierung dieser Themen durch Auswahlfächer und Abschlussarbeiten an Hochschulen unterstützt die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, die die Bauindustrie zukunftsfähig machen können.
Insgesamt verdeutlichte die Veranstaltung den enormen Innovationsschub, der mithilfe des 3D-Drucks im Bauwesen möglich ist. Dennoch erfordert die Umsetzung dieser Technologien umfassende interdisziplinäre Kooperationen sowie eine kontinuierliche Forschung und Entwicklung, um gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen wirkungsvoll zu adressieren. Der 3D-Druck steht somit nicht nur für eine technologisch, sondern auch kulturell bedeutsame Transformation im Bauwesen.
BUILTWORLD